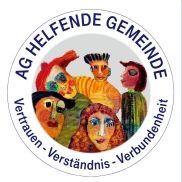ARCHIV
Besuch auf den Seelower Höhen – Ein Blick auch in die Gegenwart
Seelow, am Sonntag, 8. September 2024. Wir sitzen an einem Aussichtspunkt in der Gedenkstätte Seelower Höhen auf einem kleinen Mäuerchen und blicken über das Oderbruch. Eine weite Ebene, ein paar landwirtschaftliche Gebäude, ansonsten Felder, durchzogen von der fast schnurgerade nach Polen führenden Bundesstraße 1 und einem rechtwinklig dazu verlaufenden, mit Bäumen und Büschen bewachsenen Streifen. Später erfahren wir, dass es ein Wassergraben ist. Im Süden, kurz vor dem Horizont, ein bewaldeter Höhenzug, der sich nach Nord-Osten zu in die Ebene hineinschiebt. Alles wirkt friedlich und sonntäglich still in der warmen Spätsommersonne.
Vor etwas mehr als 79 Jahren, vom 16. bis 19. April 1945, fand hier, 75 km vom Berliner Reichstag entfernt, eine der letzten großen Schlachten des zweiten Weltkriegs statt. Mehr als 900.000 sowjetische Soldaten standen rund 100.000 deutschen Soldaten gegenüber, und doch hatten sie einen schweren Stand, mussten sie doch die Oder überqueren und dann durch sumpfiges Land den Höhenzug gewinnen, nach dem die Schlacht benannt ist: die Seelower Höhen.
Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte schildert mit manchmal allzu nüchternen Worte den mörderischen Hergang dieser Schlacht, die in nicht einmal vier Tagen geschätzt 100.000 Menschen das Leben kostete – genau kennt man die Zahl bis heute nicht. Immer wieder deutet er in die Ebene hinaus, lasst das Geschehen vor unseren inneren Augen plastisch werden, versetzt uns hinein in die Schützengräben, in denen die sowjetischen Soldaten von ihren eigenen, voranstürmenden Panzern überrollt wurden, und aus denen die deutschen Soldaten oft nicht mehr entkommen konnten. Vielleicht will er ja gerade durch seine distanzierte Erzählweise provozieren, zum Widerspruch einladen.
Fast nebenbei erfahren wir, warum General Schukow – der Befehlshaber der sowjetischen Truppen in dieser Schlacht – seine Soldaten mit solcher Eile in diese Schlacht trieb, wohl wissend, wie viele Menschenleben sie kosten würde: Im Westen standen die amerikanischen Truppen bereits an der Elbe, und hätten sie diese überquert, wäre der Weg nach Berlin nicht mehr weit. Und wer Berlin besaß, so das Kalkül, besaß auch Einfluss auf das, was nach dem Krieg in und mit Deutschland geschehen sollte. Daher wollten beide Seiten als erster in Berlin ankommen – buchstäblich um jeden Preis.
Das Mahnmal mit dem sowjetischen Soldaten, der – in der einen Hand sein Gewehr, die andere auf den Turm eines Panzers gestützt – auf das Schlachtfeld zurück blickt, ist unserem Fremdenführer wichtig. In unveränderter Sachlichkeit erzählt er uns, dass der Künstler einiges gewagt hat, als er – von den Generälen unter hohen Zeitdruck gesetzt – das Monument des Soldaten formte. Denn das Gesicht ist nicht das Gesicht eines Helden. Es ist ein Gesicht voller Schmerz und Sehnsucht. Ein stummer Versuch zu protestieren.
Natürlich kommt am Schluss die Frage, was wir denn hieraus lernen. Denn natürlich denken wir in Seelow an das, was gerade jetzt in der Ukraine geschieht – und gleichzeitig an viel zu vielen anderen Orten auf der Welt. Die Antwort? Sie bleibt offen. Vielleicht ist das richtig so, hier, auf den Seelower Höhen, wo im April 1945 zigtausend Menschen starben. Vielleicht muss sich jeder diese Frage selbst beantworten.
Text: Michael Stettberger
Olivenernte im
äußersten Süden
Europas
Sizilienreisen im Herbst 2016 und 2018
Zweimal hat die Arbeitsgemeinschaft Helfende Gemeinde eine Reise nach Riesi, Sizilien, unternommen, um dort bei der Olivenernte zu helfen: einmal im Herbst 2016 und einmal im Herbst 2018. Nachdem in Groß Glienicke viele Freunde und Bekannte Ihr Olivenöl vom Centro Servizio Cristiano der Waldenserkirche in Riesi bezogen, lag die Idee nahe, dort hin zu reisen, die Menschen dort – im Centro ebenso wie in der Stadt Riesi, einer der ärmsten Städte in Europa – kennen zu lernen und bei der Olivenernte zu helfen. 2018 schloss sich an den Aufenthalt in Riesi als weiteres Highlight ein Abstecher nach Palermo an, der nicht nur für die Fahrer unserer beiden Kleinbusse ein Abenteuer war.
Die Waldenserkirche, eine im 12. Jahrhundert von dem Lyoner Kaufmann Petrus Waldes gegründete Gemeinschaft in selbstgewählter Armut lebender Laienprediger wurde über Jahrhunderte hinweg wegen Ketzerei verfolgt. Heute ist die Waldenserkirche eine der wichtigsten protestantischen Kirchen in Italien. Als der waldensische Pfarrer Tullio Vinai im Jahre 1961 das Centro Servizio Cristiano gründete, lebte die überwiegende Mehrzahl der Menschen dort unter ärmsten Verhältnissen vom Schwefel-Bergbau. Kinderarbeit war alltäglich, die Lebenserwartung der Menschen gering, und Bildung war der kleinen Schicht der Besitzenden vorbehalten. Also gründete Vinai mit dem Centro Servicio Cristiano einen Kindergarten und eine Schule, um den Menschen ein Mindestmaß an Bildung zu ermöglichen, immer der Erkenntnis folgend, dass sich nur aus der Sklaverei befreien kann, wer überhaupt weiß, dass er Sklave ist. Heute zeugt nur noch ein Museum vom Schwefelbergbau in Riesi, und wenn auch die Arbeitslosigkeit in dieser Region Siziliens noch immer höher ist als überall sonst in Italien, ist doch die Trostlosigkeit gewichen. Wer es schafft, geht fort – heute hat er die Möglichkeit –, oder er engagiert sich in der Winzergenossenschaft, zu der auch Servizio Cristiano gehört. Oder er baut Oliven an, die in der genossenschaftlichen Ölmühle zu Olivenöl verarbeitet werden.
Wir haben auf unseren Reisen in den äußersten Süden Italiens …
· eine Menge über das Leben in einer der ärmsten Regionen Europas gelernt,
· das Centro Servizio Cristiano in Riesi durch Oliven-Pflücken dabei unterstützt, Armut durch Bildung zu bekämpfen,
· uns mit der Flüchtlings-Problematik dort auseinandergesetzt, wo die Menschen buchstäblich ihr letztes Hemd hergeben müssen, wenn sie den Ankommenden helfen wollen,
· mit den Menschen dort gesprochen und erfahren, welche Sorgen und Nöte aber auch Freuden den Arbeitsalltag z.B. eines Bürgermeisters in Sizilien bestimmen,
· uns nach getaner Arbeit aus der köstlichsten Küche des Centro Servizio Cristiano verwöhnen lassen bzw. im Centro Diakonale in Palermo auch einmal selber als Köche Hand angelegt,
· und auch die Kultur nicht zu kurz kommen lassen, in Palermo sowieso nicht, aber auch im Süden der Insel z.B. mit einem Ausflug zu den griechischen Tempeln in Agrigento.
Vielleicht die wichtigste Erfahrung, die wir als Helfende gemacht haben: Viel mehr als wir den Menschen dort hat die Reise uns selbst geholfen, vor allem, indem sie unser wohlstandsverwöhntes Weltbild ein stückweit korrigiert hat, aber auch, indem sie uns die Freude an den einfachen Dingen des Lebens wieder näher gebracht hat. Dass man uns wackeren Helfern zumindest bei der zweiten Reise extra ein paar Olivenbäume reserviert hatte, um uns überhaupt Arbeit geben zu können, haben wir (zufällig erfahren und) mit Humor genommen. Und es hat uns gezeigt, wie wenig wir am Ende doch über unsere Nachbarn im Süden wissen, die so weit doch gar nicht von uns weg sind.
Text: Michael Stettberger